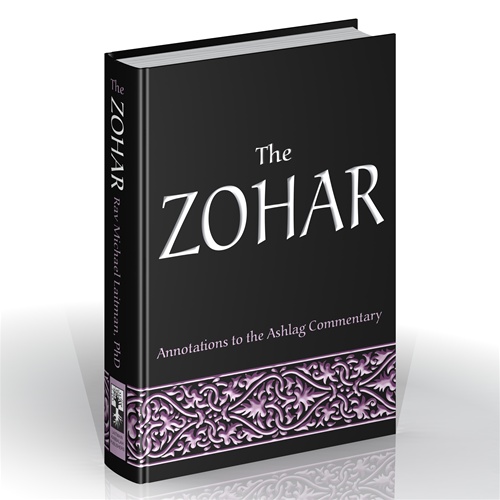„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Rabbi Akiva sagt, das sei ein großer Grundsatz der Tora.“ (Bereshit Rabba 24)
Gesamtheit und Detail
Das oben erwähnte Zitat ist zwar eine der bekanntesten und am meisten zitierten Redensarten, doch wurde es immer noch nicht in seinem ganzen Umfang erläutert. Und zwar, weil das Wort „Grundsatz“ (כלל) bzw. Gesamtheit auf eine Summe von Details hinweist, die sich auf die obere Regel beziehen, wobei jedes einzelne Detail einen Teil in sich trägt, sodass die Zusammenfügung all dieser Details diese Gesamtheit zustande bringt.
Und wenn wir sagen, „großer Grundsatz der Tora“, so bedeutet dies, dass alle Texte und alle 612 Mizwot (Gebote) die Gesamtsumme der Details darstellen, die sich auf den Vers beziehen: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“.
Doch auf den ersten Blick ist dies schwierig zu verstehen, wie solch eine Aussage „den allgemeinen Grundsatz“ aller Gebote in der Tora enthalten kann? Bestenfalls könnte er ein „allgemeiner Grundsatz“ jenes Teiles der Tora und der Texte sein, welcher sich auf die zwischenmenschlichen Gebote bezieht. Aber wie kann der weitaus größere Teil der Tora, der sich mit der Beziehung zwischen Mensch und dem Schöpfer beschäftigt, in den Rahmen des Verses „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ einbezogen werden?
Was dir selbst verhasst ist, das tue deinem Nächsten nicht an
Wenn wir irgendwie den oberen Text glätten können, sieh hier, was Hillel zu einem Fremden sagte, der zu ihm kam und darum bat, überzutreten, wie es in der Gemara heißt: „Mache mich zu einem Übergetretenen, und lehre mich die ganze Tora, während ich auf einem Fuß stehe“. Er (Hillel) sagte zu ihm: „Was dir verhasst ist, das tu deinem Nächsten nicht (im heutigen Sprachgebrauch: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu). Das ist die ganze Tora und alles andere ist nur die Interpretation, geh und lerne sie!“ Wir sehen, dass er ihm sagte, die ganze Tora sei die Interpretation des Verses: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“.
Nun ist es nach den Worten von Hillel, dem Lehrer aller Kabbalisten seiner Zeit, vollkommen klar, dass es das vordergründige Ziel unserer heiligen Tora ist, uns auf jene erhabene Stufe zu bringen, wo wir diesen Vers einhalten können, weil es im Besonderen heißt: „Alles andere ist nur die Interpretation, geh und lerne sie!“ Das bedeutet, dass man uns erklärt, wie wir zu diesem Grundsatz kommen können.
Es verwundert, dass solch eine Aussage in den meisten Themen der Tora wahr sein kann, welche den Menschen und Gott betreffen, wenn doch jeder Anfänger offensichtlich weiß, dass es das Herzstück der Tora ist, und nicht die Erklärung von „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“.
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
Wir sollten außerdem die Bedeutung des Verses „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ prüfen und verstehen. Die wörtliche Bedeutung davon ist es, deinen Nächsten im selben Maße zu lieben, wie du dich selbst liebst. Doch wir sehen, dass die Allgemeinheit dem überhaupt nicht standhalten kann. Hieße es, liebe deinen Freund so sehr, wie er dich liebt, könnten auch dies nur wenige Menschen vollkommen einhalten, doch es wäre akzeptabel.
Doch den anderen so sehr zu lieben, wie ich mich selbst liebe, scheint unmöglich. Sogar wenn es in der ganzen Welt nur eine Person außer mir gäbe, wäre es unmöglich, und es ist noch weniger möglich, wenn die Welt voller Menschen ist. Mehr als das, wenn ein Mensch wen auch immer so lieben würde wie er sich selbst liebt, hätte er keine Zeit für sich selbst. Denn man muss bereitwillig die eigenen Bedürfnisse befriedigen, ohne Verzicht, denn man liebt sich selbst.
Was die Bedürfnisse der Allgemeinheit betrifft, ist dem nicht so; denn der Mensch hat keinen triftigen Grund, der in ihm den Wunsch erwecken würde, für sie zu arbeiten – und selbst, wenn er wollte, würde er es wörtlich erfüllen können, würde seine Kraft standhalten? Und wenn dem nicht so ist, wie kann die Tora uns dazu verpflichten, etwas zu tun, was der Mensch überhaupt nicht einhalten kann?
Und wir sollten keineswegs annehmen, dass diese Worte übertrieben sein könnten; denn wir werden durch den folgenden Vers erinnert: „Du sollst dem nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen“. Alle Kommentatoren waren sich darin einig, den Text wörtlich zu interpretieren. Mehr als das; sie sagten, dass man die Bedürfnisse seines Nächsten sogar dann befriedigen soll, wenn man selbst bedürftig ist. Sogar dann müssen wir die Bedürfnisse unseres Freundes befriedigen und unsere eigenen unbefriedigt lassen.
Die Tosfot (Ergänzungen in der Gemara) sagten, dass für jedermann gilt, der einen israelitischen Sklaven kauft, dass es so ist, als kaufe er sich selbst einen Herren. Und die Tosfot interpretierten die Situation, wenn man nur ein Kissen hat und selbst darauf liegt, man nicht das Gebot einhält: „Denn es ist ihm gut mit dir“. Und wenn man selbst nicht darauf liegt und das Kissen seinem Sklaven nicht gibt, dann ist dies eine sodomitische Regelung. Es stellt sich heraus, dass man ihn gegen den eigenen Willen an seinen Diener geben muss. Daraus folgt, dass man sich selbst einen Herrn kaufte.
Eine Mizwa (ein Gebot)
Das bringt einige Fragen auf: Gemäß dem vorher Gesagten verstoßen wir alle gegen die Tora. Des Weiteren halten wir den vordergründigen Teil der Tora nicht ein, ihre Essenz, da wir die Einzelheiten einhalten, nicht aber die Gesamtheit (nicht das eigentliche Gesetz). Es steht geschrieben: „Wenn ihr den Willen des Schöpfers einhaltet, sind die Armen bei anderen, doch nicht bei euch“. Doch wie ist es möglich, dass es Arme geben wird, wenn jeder die Gesamtheit (das allgemeine Gesetz der Nächstenliebe) einhält, den Wunsch des Herrn, und seinen Nächsten wie sich selbst liebt?
Das Frage des hebräischen Sklaven, die der Jerusalemer [Talmud] aufwirft, bedarf einer weiteren Untersuchung: Die Bedeutung des Textes ist es, dass man seinen Sklaven wie sich selbst lieben soll, sogar wenn es sich auf einen Ausländer oder einen Fremden bezieht, der kein Hebräer ist. Und man hat keine Ausreden, denn die Regelung für den Fremden ist die Regelung für einen Hebräer, da „Ein Gesetz und eine Verordnung soll es geben, sowohl für dich als auch für den Fremden, der mit dir verweilt“. Das Wort Ger [Ausländer/Übergetretener] meint auch einen „teilweise Übergetretenen“, also einen, der nicht die Tora annimmt, sondern sich nur dem Götzendienst entzieht. Es steht über solch eine Person geschrieben: „Du darfst sie dem Fremden geben, der in deinen Toren wohnt.“
Und das ist die Bedeutung der Worte des Tana [1]: „Derjenige, der ein Gebot erfüllt, neigt sich selbst und die ganze Welt der Seite des Verdienstes zu“. Und es ist sehr schwer zu verstehen, was die „ganze Welt“ damit zu tun hat? Und wir sollten uns nicht selbst rechtfertigen, es gehe um den Fall, dass man halb unwürdig und halb würdig ist und die ganze Welt halb unwürdig und halb würdig ist, denn wenn wir das sagen, verfehlen wir den ganzen Sinn.
Außerdem ist die ganze Welt voll von Nichtjuden und Tyrannen, wie kann er also sehen, dass sie halb unwürdig und halb würdig sind?
Man kann an sich selbst erkennen, dass man halb Gerechter und halb Sünder sei, aber nicht an der ganzen Welt als solche. Außerdem sollte der Text mit „ganz Israel“ beginnen, doch warum heißt es „die ganze Welt“? Bürgen wir für die ganze Welt? Fügen wir sie zu unserem Guthaben an guten Taten hinzu?
Wir müssen verstehen, dass unsere Weisen nur von dem praktischen Teil der Tora sprachen, welcher die Welt und die Tora zum ersehnten Ziel bringt. Wenn sie also von einer Mizwa (einem Gebot) sprechen, dann meinen sie mit Sicherheit eine praktische Mizwa. Und das ist sicherlich wie Hillel sagt, „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“. Durch diese Mizwa allein erreicht der Mensch das wahre Ziel, nämlich die Anhaftung [Dwekut] an seinen Schöpfer. Tatsächlich siehst du, dass der Mensch durch diese Mizwa die ganze Welt und das Ziel aufrechterhält.
Nun stellt sich nicht mehr die Frage nach den Mizwot zwischen Mensch und Gott, da die praktischen von ihnen den gleichen Zweck haben, den Körper zu reinigen, der letzte Punkt, von dem es heißt, den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Die unmittelbare Phase danach ist die Anhaftung.
Und darin gibt es die Gesamtheit und das Detail. Wir gehen vom Detail zur Gesamtheit, da die Gesamtheit zum Endziel führt. Tatsächlich macht es mit Sicherheit keinen Unterschied, von welcher Seite wir beginnen, vom Detail oder von der Gesamtheit, solange wir beginnen und nicht still halten, bis wir unser Ziel erreichen.
Und Ihm anhaften
Es bleibt immer noch Raum, um zu fragen: wenn der Zweck der Tora und der ganzen Schöpfung nichts anderes ist, als die niederträchtige Menschheit zu erheben, bis wir schließlich dieser prächtigen Erhabenheit – der Dwekut [Anhaftung] an den Schöpfer – würdig werden, so hätte der Schöpfer uns doch gleich in dieser Erhabenheit erschaffen können, anstatt uns mit der Arbeit zu erschweren, die es in der Schöpfung und in der Tora und den Mizwot gibt. Wir könnten das mit den Worten unserer Weisen erklären: „Einer, der isst, was nicht Seines ist, fürchtet sich, einem ins Gesicht zu schauen“. Das meint, dass jeder, der die Früchte der Arbeit von anderen verzehrt, sich fürchtet (schämt), seine eigene Gestalt anzuschauen, denn seine Gestalt ist unmenschlich.
Da kein Mangel von Seiner Vollkommenheit ausgehen kann, bereitete er Arbeit für uns vor, dass wir die Arbeit unserer eigener Hände genießen könnten. Deswegen erschuf er das Geschöpf in seiner niederen Form. Die Arbeit in der Tora und in den Mizwot erhebt uns aus der Niederträchtigkeit der Schöpfung, und durch sie erreichen wir unsere Erhabenheit selbstständig. Dann empfinden wir nicht den Genuss und die Wonne, als kämen sie von einer großzügigen Hand, als Geschenk, sondern wir nehmen uns als Besitzer dieses Genusses wahr.
Doch wie dem auch sei, wir müssen immer noch die Quelle der Niederträchtigkeit nachvollziehen, die wir fühlen, wenn wir ein Geschenk erhalten. Naturwissenschaftler wissen, dass jeder Zweig seiner Wurzel nahe ist. Der Zweig liebt alle Eigenschaften der Wurzel, will sie, begehrt sie und zieht Nutzen aus ihnen. Umgekehrt hält sich der Zweig von allem fern, was nicht in der Wurzel ist; er kann es nicht ertragen und wird von ihm geschädigt. Und da unsere Wurzel der Schöpfer ist und Er nicht empfängt, sondern gibt, fühlen wir Leid und Erniedrigung bei jedem Empfang von einem anderen.
Nun verstehen wir den Sinn des Anhaftens an Ihn. Die Erhabenheit von Dwekut [Anhaftung] an Ihn ist lediglich die Übereinstimmung des Zweiges mit seiner Wurzel, und der ganze Sinn der Niederträchtigkeit ist nur die Entfernung von der Wurzel. Mit anderen Worten: Jedes Geschöpf, dessen Wege korrigiert werden, um anderen zu geben, erhebt sich und wird fähig, an Ihm anzuhaften, und jedes Wesen, dessen Weg das Empfangen und die Eigenliebe ist, wird erniedrigt und weit vom Schöpfer entfernt.
Als ein Heilmittel wurden uns die Tora und die Mizwot gegeben. Am Anfang müssen wir sie Lo Lishma einhalten, d.h. um der Belohnung willen. Das ist während des Zeitraumes von Katnut (des Kleinseins) der Fall, während der Erziehungsphase. Wenn man erwachsen wird, wird einem beigebracht, die Tora und die Mizwot Lishma einzuhalten, d.h. um dem Erschaffer Genuss zu bereiten, und nicht aus Selbstliebe.
Jetzt können wir die Worte unserer Weisen verstehen, die fragten: „Warum sollte es den Schöpfer interessieren, ob man an der Kehle oder am Nacken schlachtet? Schließlich wurden die Mizwot [Gebote] nur deshalb gegeben, um die Menschen durch sie zu reinigen.“
Doch wir wissen immer noch nicht, was dieses Reinigen ist. Wenn wir das zuvor Erwähnte beachten, so wissen wir dass „der Mensch als ein wilder Esel auf die Welt kommt“. Und wir sind vollkommen in den Schmutz und die Niederträchtigkeit des Empfanges für sich selbst und der Selbstliebe getaucht, ohne jeglichen Funken von Liebe zum Nächsten und vom Geben. In diesem Zustand befindet sich der Mensch am entferntesten Punkt von der Wurzel.
Wenn man wächst und durch Tora und Mizwot erzogen wird, und zwar bestimmt durch das Ziel, seinem Erschaffer Freunde zu bringen, und nicht aus Selbstliebe, kommt man zu der Stufe des Gebens an den Nächsten. Man gelangt zu dieser Stufe durch das natürliche Heilmittel, welches im Studium der Tora und der Mizwot Lishma eingeschlossen ist, von welchem der Geber der Tora weiß, wie unsere Weisen sagten: „Ich habe den bösen Trieb erschaffen, und ich schuf die Tora als Gewürz (Heilmittel)“.
Dadurch entwickelt sich das Geschöpf auf den Stufen der hohen Erhabenheit, bis man jegliche Form von Selbstliebe und Empfangen für sich selbst verliert. In diesem Zustand ist jede Eigenschaft des Menschen, entweder zu geben, oder zu empfangen um zu geben. Unsere Weisen sagten darüber: „Die Mizwot wurden nur gegeben, um die Menschen durch sie zu reinigen“, und dann steigt man zu seiner Wurzel auf, wie es heißt, „und Ihm anzuhaften“.
Zwei Teile der Tora: zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch
Sogar wenn wir sehen, dass es in der Tora zwei Teile gibt: einmal die Mizwot zwischen Mensch und Gott, und zweitens die Mizwot zwischen Mensch und Mensch, sind sie doch beide das Gleiche. Das bedeutet, dass ihr eigentlicher Zweck und das ersehnte Ziel Eins sind, und zwar Lishma.
Es macht keinen Unterschied, ob der Mensch für seinen Nächsten oder für den Schöpfer arbeitet. Das hat zum Grund, dass es in uns durch die Natur der Schöpfung eingemeißelt ist, dass alles, was von einem anderen kommt, uns leer und irreal erscheint.
Deswegen sind wir gezwungen, bei Lo Lishma anzufangen. Maimonides [2] sagt: „unsere Weisen sagten: „Man muss immer die Tora studieren, und zwar sogar Lo Lishma, denn von Lo Lishma kommt man zu Lishma“. Deshalb werden die Jungen, die Frauen und die Ungebildeten gelehrt, aus Ehrfurcht zu arbeiten und um Belohnung zu empfangen. Bis sie Wissen ansammeln und Weisheit erlangen, werden sie nach und nach in dieses Geheimnis eingeweiht und mit Leichtigkeit an diese Angelegenheit gewöhnt, bis sie Ihn erlangen und Ihn kennen und Ihm aus Liebe dienen“.
Wenn man dabei seine Arbeit in Liebe und Geben zum Nächsten vollendet und beim höchsten Punkt ankommt, vollendet man auch seine Liebe zum Schöpfer und das Geben an den Schöpfer. In diesem Zustand gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden, da alles, was außerhalb des Körpers eines Menschen ist, d.h. außerhalb seines Selbstinteresses, auf gleiche Weise beurteilt wird- ob es darum geht, seinem Nächsten zu geben, oder um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten.
Das ist es, was Hillel Hanasi meinte, und zwar dass „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ das absolute Ziel in der Praxis sei. Denn das ist die klarste Form für den Menschen.
Wir sollen nicht über die Taten irren, denn diese werden vor die Augen des Menschen gesetzt. Und wisse, dass wenn man die Bedürfnisse des Freundes vor die eigenen stellt, dass das Geben ist. Deswegen definiert Hillel das Ziel nicht als „Und du sollst den Ewigen deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen“, denn es ist tatsächlich beides das Gleiche. Es ist so, weil man auch seinen Freund mit seinem ganzen Herzen und seiner ganzen Seele und seiner ganzen Kraft lieben soll, denn das ist der Sinn der Worte „wie dich selbst“. Immerhin liebt man sicherlich sich selbst mit seinem ganzen Herzen und Seele und allet Kraft, doch hinsichtlich des Schöpfers könnte man sich irren, und mit dem Freund liegt es immer vor den Augen.
Warum wurde die Tora nicht den Vorvätern gegeben?
Das beantworten die ersten drei Fragen. Doch es bleibt immer noch die Frage, wie es möglich ist, dies einzuhalten, denn es scheint unmöglich. Du sollst wissen, dass dies der Grund ist, aus dem die Tora nicht den Vorvätern gegeben wurde, sondern ihren Kindeskindern, die eine ganze Nation waren, bestehend aus 600.000 Männern beginnend vom Alter von 20 Jahren. Sie bekamen sie, nachdem sie gefragt wurden, ob jeder von ihnen gewillt sei, diese Arbeit und dieses erhabene Ziel auf sich zu nehmen.
Nachdem jeder einzelne sagte: „Wir werden tun und wir werden hören“, wurde es möglich. Denn zweifellos, wenn 600.000 Männer keinen anderen Willen haben, als Wache zu stehen und darauf zu achten, dass ihre Freunde keinen einzigen unerfüllten Wunsch haben, und sie es sogar liebend tun, mit ihrer ganzen Seele und ihrem ganzen Vermögen, besteht absolut kein Zweifel, dass es niemanden im ganzen Volk geben wird, der sich um seinen Unterhalt kümmern müsste. Und zwar, weil er 600.000 liebende und treue Menschen haben wird, die sicherstellen werden, dass kein einziger seiner Wünsche unbefriedigt bleibt.
So beantworten wir die Frage, warum die Tora nicht unseren heiligen Patriarchen gegeben wurde. Das hat zum Grund, dass in einer kleinen Gruppe von Menschen die Tora nicht eingehalten werden kann. Es ist unmöglich, mit der Arbeit von Lishma zu beginnen, wie es oben beschrieben wurde. Deswegen wurde ihnen die Tora nicht gegeben.
Ganz Israel bürgt füreinander
Im Lichte des oben Gesagten können wir die verwirrende Redensart unserer Weisen verstehen, die sagten: „Ganz Israel bürgt füreinander“. Außerdem fügt Rabbi Elazar, der Sohn von Rabbi Shimon hinzu, dass „die Welt nach der Mehrheit beurteilt“ werde.
Es folgt, dass wir auch für alle Völker der Erde verantwortlich sind. Ich wundere mich; das scheint etwas zu sein, was der Verstand nicht dulden kann. Wie kann einer für die Sünden des anderen verantwortlich sein, den er nicht kennt? Es heißt im Besonderen: „Die Väter sollen nicht wegen ihrer Söhne getötet werden, und die Söhne sollen nicht wegen ihrer Väter getötet werden; jeder Mensch sollte für seine eigene Sünde hingerichtet werden“.
Nun können wir leicht die Bedeutung der Worte verstehen. Es ist schier unmöglich, die Tora und die Mizwot einzuhalten, wenn nicht die ganze Nation teilnimmt. Es stellt sich heraus, dass jeder Einzelne verantwortlich für seinen Freund wurde. Das meint, dass die Abtrünnigen diejenigen, welche die Tora einhalten, dazu bringen, in ihrem Schmutz zu verweilen. Sie können nicht korrigiert werden, und nicht zum Geben und zur Liebe zum Nächsten gelangen, ohne dass die Abtrünnigen daran teilnehmen. Wenn also einige im Volk Sünder sind, bringen sie den Rest des Volkes dazu zu leiden.
Im Midrash heißt es, „Israel, einer von ihnen sündigt und sie alle fühlen es“. Rabbi Shimon sagte darüber: „Es ist wie bei Menschen, die in einem Boot sitzen. Einer von ihnen nimmt einen Bohrer und beginnt, unter seinem Sitz zu bohren. Seine Freunde sagten ihm: „Was tust du?“ Er antwortete, „Warum sollte es euch kümmern? Bohre ich nicht etwa unter mir?“ Sie antworteten, „Das Wasser überschwemmt das Boot“ Wie wir oben erklärt haben, da die Abtrünnigen in Selbstliebe getaucht sind, schaffen ihre Taten eine Stahlmauer, welche diejenigen, welche die Tora einhalten, davon abhält, auch nur zu beginnen, die Tora und die Mizwot auf richtige Weise einzuhalten.
Nun werden wir die Worte von Rabbi Elazar, dem Sohn von Rabbi Shimon, klären, der sagt: „Da die Welt nach der Mehrheit gerichtet wird, und das Individuum nach der Mehrheit gerichtet wird, gilt, dass wenn ein Einzelner eine Mizwa ausführt, gesegnet sei er, denn er neigt sich selbst und die ganze Welt der Waagschale (der Seite) des Verdienstes zu. Wenn er eine Sünde begeht, wehe ihm, denn er neigt sich selbst und die ganze Welt der Waagschale der Schuld zu. Wie es heißt, `doch ein Sünder zerstöret viel Gutes´“.
Wir sehen, dass Rabbi Elazar, der Sohn von Rabbi Shimon, das Thema von Arwut (der gegenseitigen Verantwortung/ Bürgschaft) sogar verschärft, indem er sagt, „die Welt wird nach der Mehrheit gerichtet“. Das ist so, weil er der Meinung ist, dass es nicht genügt, wenn ein Volk die Tora und die Mizwot empfängt. Entweder kam er zu dieser Meinung durch Betrachtung der Realität, denn wir sehen, dass das Ende noch nicht gekommen ist, oder empfing er sie von seinen Lehrern.
Der Text (der Schrift) unterstützt ihn auch, indem er uns verspricht, dass sich in der Zeit der Erlösung „die Erde mit dem Wissen des Herren füllen“ wird, und auch, „und alle Völker werden zu Ihm fließen“, und viele andere Verse. Das ist der Grund, warum er Arwut durch die Teilnahme der ganzen Welt bedingte. Es zeigt, dass ein Einzelner nicht durch das Einhalten der Tora und der Mizwot zum erwünschten Ziel gelangen kann, wenn es nicht durch die Hilfe aller Menschen in der Welt geschieht.
Also beeinflusst jede einzelne Mizwa, die der Mensch ausführt, die ganze Welt. Es gleicht einem Menschen, der in einer Waagschale ein gewisses Gewicht von Bohnen abwiegt. So wie jede einzelne Bohne, die man in die Waagschale legt, die erwünschte Endentscheidung ausschlaggebend beeinflusst, ist auch jede Mizwa, die ein Einzelner ausführt, damit sich die Welt mit dem Wissen des Schöpfers fülle, dazu beiträgt, dass die Welt sich entwickeln würde und dass man zu diesem Gesetz gelangen würde.
Es steht geschrieben, „Doch ein Sünder zerstöret viel Gutes“. Das meint, dass die Sünde eines Einzelnen das Gewicht auf der Waagschale reduziert, als würde jener Mensch die Bohnen zurücknehmen, die er auf die Schale legte. Dadurch wendet er die Welt nach hinten.
Warum wurde die Tora an Israel gegeben?
Nun können wir die Frage beantworten: „Warum wurde die Tora dem Volk Israel gegeben, ohne die Teilnahme aller Völker in der Welt?“ In Wahrheit ist es so, dass sich das Schöpfungsziel auf das gesamte Menschengeschlecht bezieht, niemanden ausgenommen. Doch wie dem auch sei war es wegen der Niederträchtigkeit der Natur der Schöpfung und deren Macht über die Geschöpfe nicht möglich für den Menschen, dazu fähig zu sein, zu verstehen, sie in die Knie zu zwingen, und sich damit einverstanden zu geben, sich über sie zu erheben. Sie zeigten kein Verlangen, aus den Schranken der Selbstliebe auszutreten, und zur Übereinstimmung der Form zu gelangen, welche die Verschmelzung mit den Eigenschaften des Schöpfers ist. Wie unsere Weisen sagten, „Wie Er barmherzig ist, so sollst auch du barmherzig sein“.
Und wegen des Verdienstes der Vorväter hatte das Volk Israel Gelingen darin, nachdem sie sich im Verlauf von vierhundert Jahren entwickelt und ausgebildet hatten, und sich der Seite des Verdienstes zugeneigt hatten. Und jeder einzelne von den Mitgliedern der Nation trat durch diese Annahme der Nächstenliebe in das Sein eines kleinen Volkes inmitten von siebzig großen Völkern ein, wobei jedem Einzelnen aus dem Volk Israel Hundert und mehr Götzendiener gegenüberstehen. Und als sie die Nächstenliebe auf sich nahmen, wurde die Tora gerade dem israelischen Volk zur Selbstvervollkommnung gegeben.
Doch das Volk Israel wurde dazu bestimmt, der „Vermittler“ (der „Übergang“) zu sein. Das meint, dass insoweit wie Israel sich durch das Einhalten der Tora reinigt, es seine Kraft an den Rest der Völker weiterleitet. Und sobald sich auch der Rest der Völker der Waagschale des Verdienstes zuneigt, wird sich der Messias offenbaren. Und zwar, weil die Rolle des Messias es ist, nicht nur Israel für das Endziel der Verschmelzung mit Ihm zu qualifizieren, sondern alle Völker die Wege Gottes zu lehren, wie der Vers sagt: „Und alle Völker werden in Ihn hineinfließen“.
[1] Einer der Weisen der Mishna, des Grundstücks des Talmuds
[2] RAMBAM: Rav Moses ben Maimonides, 13 Jh., Kabbalist und Interpret der Tora und anderer Bücher der Schrift und des Talmuds.
korr, EY, 25.12.2024